
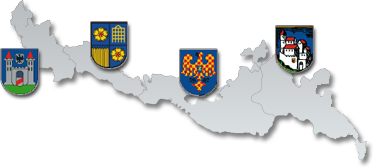

Altstadt – heute Staré Město pod Landštejnem. Foto: NÖ Landesarchiv/Wolfgang Kunerth
Arbeit und Aufstieg bestimmten in den Jahrzehnten nach der erfolgreichen Konsolidierung der Verhältnisse das Leben der Vertriebenen. Die Herkunft wurde zwar nicht verschwiegen, aber auch nicht öffentlich thematisiert: „Zur damaligen Zeit ist ja alles, was mit Hitler und Vertreibung und Russen, alles totgeschwiegen gewesen (…). Auch die Vertreibung.” Die emotionale Bewältigung des Geschehenen fand oft nicht einmal im engsten Kreis statt: „Ansonsten ist eigentlich in der Familie auch nicht viel drüber gesprochen worden. Weil da immer wieder ein bisserl Wehmut aufgekommen ist, je öfter man das besprochen hat, ist das wieder dagewesen.”
Es dominierte die Anpassung, begünstigt durch die große geographische und kulturelle Nähe von Herkunfts- und Aufnahmeregion vor allem im Wald- und Weinviertel: „Ich habe mich immer eingefügt. Und es ist mir überall wieder zu Gute gekommen. (…) Ich habe das weggesteckt. Weil ein Zurück gibt es nicht mehr.” Ein Aufstieg in den niederösterreichischen Ortschaften, Parteien und Vereinen gelang nicht wegen, sondern losgelöst von der Herkunft. Prämiert wurde dabei der berufliche und soziale Erfolg, der die Erlebnisse der Hilflosigkeit der Anfangsjahre vergessen machen sollte: „Mich sieht keiner als Vertriebener – mich sieht jeder als Integrierter, als Österreicher.” Nur eine Minderheit der damals Jungen wurde in den Vertriebenenverbänden sozialisiert: „Auf Wunsch der Eltern bin ich jeden Dienstag in die Weidmanngasse zur Sudetendeutschen Jungmannschaft gegangen.”
Die ersten Besuche in der „alten Heimat” wurden meist mit den Eltern in den 1960er Jahren unternommen, als sich das Regime in der kommunistischen Tschechoslowakei gelockert hatte und die größte Not in der neuen Heimat überwunden war: „Ich bin sehr oft mit meiner Mutter rübergefahren, die hat immer in die Heimat wollen, sie hat immer gesagt, zum Muttertag und Geburtstag.” Doch die Begegnungen endeten oft enttäuschend: „Und wie wir drüben umeinandergangen sind, hat der Vater gesagt, steigts in das Auto rein, wir fahren gleich wieder zurück, ich will nicht sterben da (…). Hat er gesagt, nie mehr, das ist für uns abgeschlossen.”

Sonntägliches Treffen von Vertriebenen am Schlagbaum in Drasenhofen, um 1960.
Konnte man anfangs noch an der Grenze die Entwicklung „drüben” beobachten, so wurden in den 1950er Jahren dutzende Ortschaften niedergewalzen, verschwanden die Heimatregionen hinter dem Stacheldraht. Berichte in der Zeitschrift „Der Südmährer” zeichneten die Umwandlung der Herkunfts-Landschaften durch Neubesiedelung, Kollektivierung und Zwangsmodernisierung nach. Je trister die Berichte aus der Gegenwart, umso idyllischer wurden die Erinnerungen an das Land der Kindheit, das nach dem erneuten „Dichtmachen” der Grenzen der Tschechoslowakei in den 1970er Jahren zunehmend ins Imaginäre hinüberwuchs. Aus dem Herkunftsland wurde „Sehnsuchtsland.” Die Heimatorte lebten als fiktive Gemeinschaft mit ihren Ortsbetreuern und den monatlichen Berichten im „Südmährer” fort, die Heimattreffen waren vor allem Wiedersehensfeiern: „Was haben wir für eine Freude gehabt, wie wir uns wiedergesehen haben, wir sind aneinander gehängt wie Bienen.”
Zum Ritual der Besuche der nach Deutschland ausgesiedelten Verwandten in Niederösterreich gehörten die gemeinsamen Fahrten an die Grenze: „Da haben wir die Kinder mitgehabt, da haben wir rübergeschaut.” Doch die Weitergabe von Wissen und Interesse an die nachfolgende Generation, an die eigenen Kinder, gelang nur selten: „Sie haben keinen sehr engen Bezug mehr zu dieser Zeit. Ihr Leben ist da.”
(Text von Niklas Perzi aus der Ausstellung „Langsam ist es besser geworden. Vertriebene erzählen vom Wegmüssen, Ankommen und Dableiben”)